Are you looking for a specific topic? Use the search function at the top right.
Sind Sie auf der Suche nach einem bestimmten Thema? Nutzen Sie die Suchfunktion oben rechts.
Wenn Sie unser Magazin kostenfrei abonnieren möchten, schicken Sie eine Mail mit dem Betreff FELD und Ihren Kontaktdaten an: feld@zalf.de.
Sie möchten die neuen FELD-Ausgaben lieber online nachlesen?
Dann registrieren Sie sich für den Newsletter auf unserem Online-Blog zum Magazin: www.quer-feld-ein.blog
FELD 01/2022
- Text
- Artificial intelligence
- Künstliche intelligenz
- Precision farming
- ökosystemleistungen
- Intensivierung
- Nachhaltigkeit
- ökosysteme
- Anbausystem
- Landschaftslabor
- Patchcrop
- Zalf
- Landwirtschaft
Interview WER ZAHLT DIE
Interview WER ZAHLT DIE RECHNUNG? Welche Herausforderungen der freie Zugang zu Forschungsergebnissen mit sich bringt. Herr Dalchow, Sie sind Publikationsmanager am ZALF. Was genau bedeutet das? Die Leistung einer Forschungseinrichtung wie des ZALF wird zum großen Teil über die veröffentlichten wissenschaftlichen Artikel abgebildet. Hierbei geht es um die Publikationsanzahl, aber auch die Reichweite der Fachjournale, in denen veröffentlicht wird. Ich behalte hier am ZALF den Überblick und gebe unseren Forscherinnen und Forschern gegebenenfalls Ratschläge, wo und wie sie ihre Arbeiten am besten platzieren können. In der Welt der wissenschaftlichen Veröffentlichungen sehen Sie einen großen Umbruch auf uns zukommen. Was genau meinen Sie damit? Die Verlage der Fachjournale finanzieren sich bisher noch weitgehend, indem Forschungseinrichtungen dafür bezahlen, Zugang zu den gewünschten Artikeln zu erhalten. Der Preis hängt davon ab, wie viele Menschen in einer Einrichtung diesen Zugang nutzen können. Das ganze System wird also von Seiten der Leserinnen und Leser finanziert. Der Umbruch findet nun statt, weil Open Access dieses Verhältnis umkehrt. Open Access? Open Access bedeutet, dass wissenschaftliche Ergebnisse, hier in Form der Artikel, allen digital frei zur Verfügung stehen. Schließlich werden sie ja auch zum Großteil mit Steuergeldern finanziert. Es begann als Graswurzelbewegung, doch jetzt machen es auch große Verlagshäuser sowie Forschungsförderer mehr und mehr zum neuen Standard. Das klingt doch erstmal positiv. Wieso haben Sie Bedenken? Kurz gesagt: Irgendwer zahlt immer. Die Verlagshäuser und Ihre Angestellten müssen natürlich weiterhin finanziert werden. Das neue Modell sieht vor, dass Forschungseinrichtungen einen Festpreis für jeden Artikel bezahlen, den sie dort publizieren. Vorher wurde für das Lesen bezahlt, jetzt für das Veröffentlichen. Das bedeutet aber, dass nur publizieren kann, wer auch das Budget dafür hat. Die Geldgeber werden somit Forschungseinrichtungen, die viel veröffentlichen, anders ausstatten müssen, als zum Beispiel eine Bibliothek. Das wurde bislang kaum mitgedacht, und finanzielle Umverteilungen sind ohnehin konfliktträchtig. Der Prozess des Peer-Review, also die Qualitätssicherung der Artikel durch unabhängige Gutachterinnen und Gutachter aus dem gleichen Fachgebiet, bleibt aber soweit unberührt? Grundsätzlich erst einmal ja. Er ist enorm wichtig für die Integrität der Forschungsarbeiten. Doch bisherige Open-Access-Angebote haben auch hier neue Stolperfallen aufgezeigt. Was meinen Sie damit? Ein Fachjournal ist kein gedrucktes Heft mehr, sondern eine Webseite. Nur so wird Open- Access ja überhaupt erst umsetzbar. Das bedeutet aber auch, dass ein neues Open-Access-Journal schnell aus dem Boden gestampft ist. Ob es sich dabei um ein seriöses Journal handelt, ist für viele nur schwer nachzuvollziehen. Es gab bereits tausende Fälle, in denen Forschende, die ja unter hohem Publikationsdruck stehen, Geld an sogenannte Raubjournale gezahlt haben. Bei denen war das Peer-Review zum Beispiel nur vorgetäuscht. Dies ist für mich ein weiteres Beispiel, wie sehr wir aufpassen müssen, wenn Open- Access zunehmend zum Standard wird. Das Interview führte Tom Baumeister. Die Kampagne »Think. Check. Submit.« stellt Checklisten zur Verfügung, die Forschenden helfen, anerkannte Fachzeitschriften von sogenannten Raubjournalen (engl.: predatory journals) zu unterscheiden. https://thinkchecksubmit.org/ DR. CLAUS DALCHOW leitet am ZALF die Bibliothek sowie das Publikationsmanagement. 32 33
- Seite 1 und 2: FELD MAGAZIN DES LEIBNIZ-ZENTRUMS F
- Seite 4: TITELTHEMA SCHACHBRETT AUF DEM ACKE
- Seite 8: patchCROP patchCROP die Forscherinn
- Seite 12: patchCROP patchCROP Es muss für de
- Seite 16: Ökosystemleistungen Ökosystemleis
- Seite 20: Ökosystemleistungen Ökosystemleis
- Seite 24: INTENSIV, ABER NACHHALTIG 2 12 13 1
- Seite 28: Nachhaltig intensiv Nachhaltig inte
- Seite 32: Keine Zeit zum Lesen? Dann hör doc
- Seite 38: Künstliche Intelligenz Künstliche
- Seite 42: Das Leibniz-Zentrum für Agrarlands
Unangemessen
Laden...
Magazin per E-Mail verschicken
Laden...
Einbetten
Laden...
FELD (dt.)
Neu im querFELDein-Podcast
Would you prefer to read the new FELD issues online?
Then register for the newsletter on our online blog: www.quer-feld-ein.blog

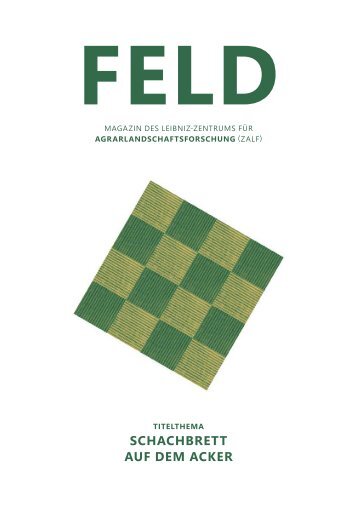
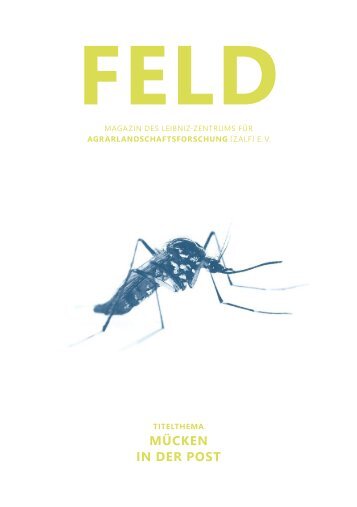
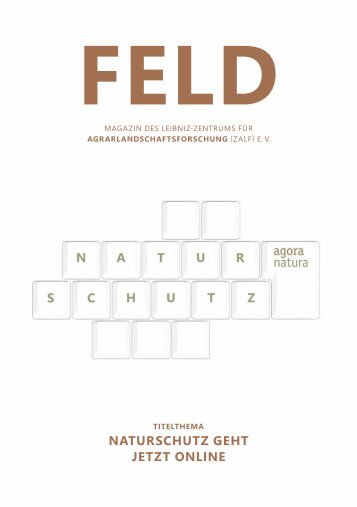
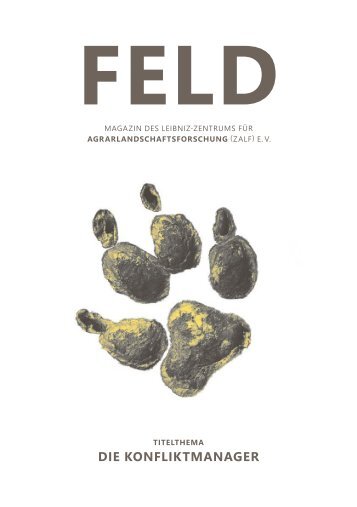
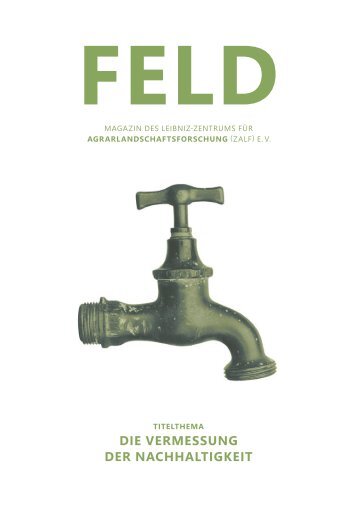
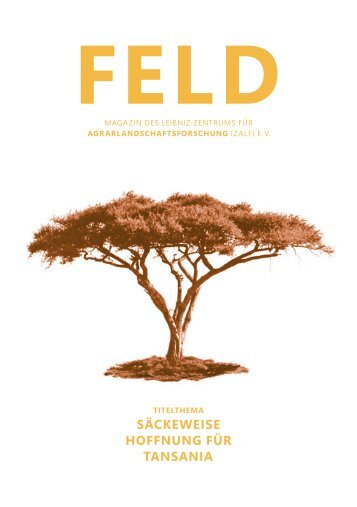
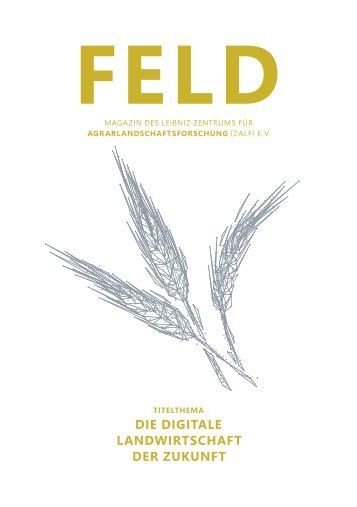
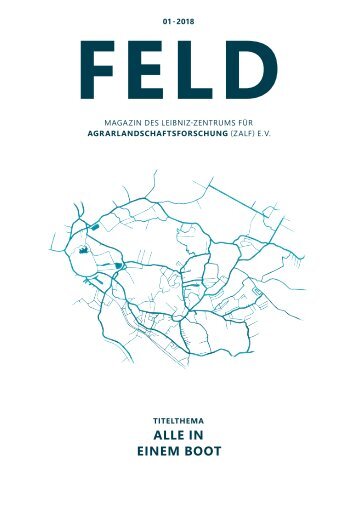
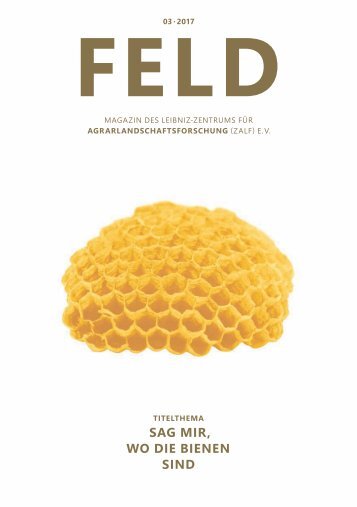


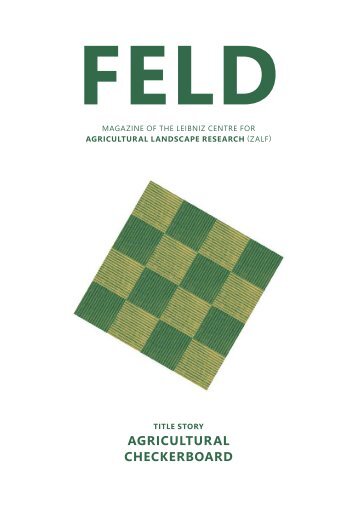
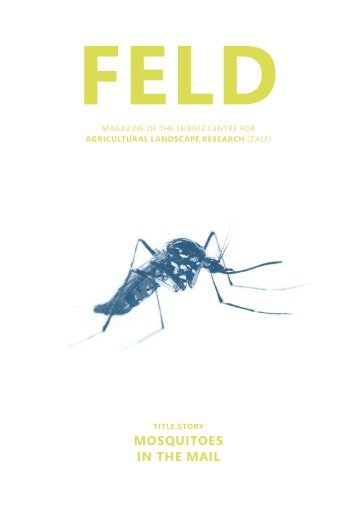
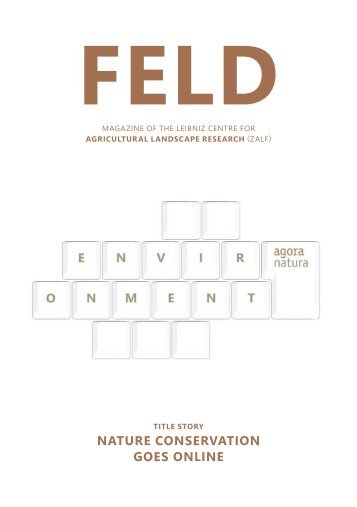
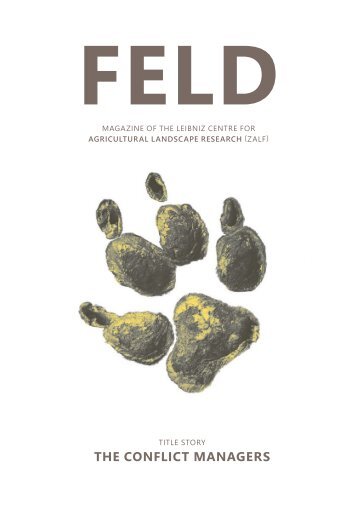
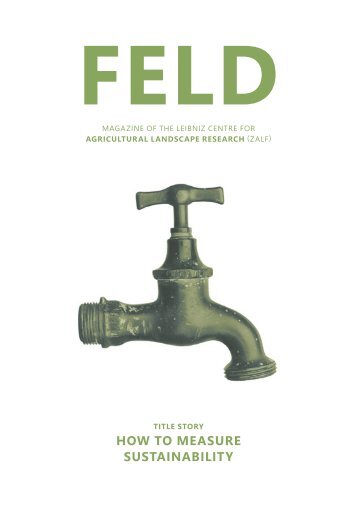
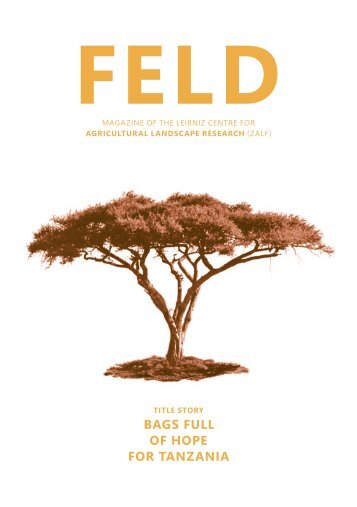
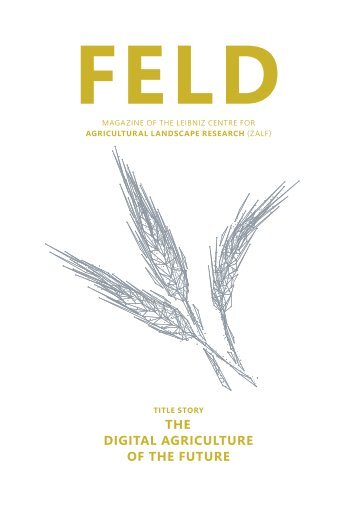
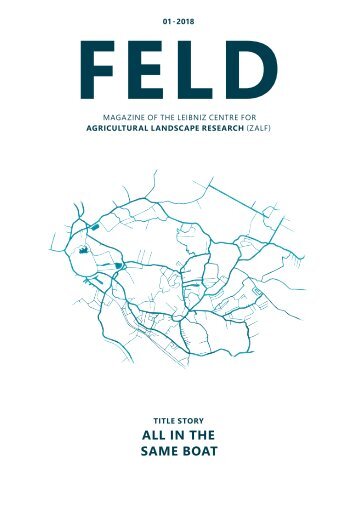
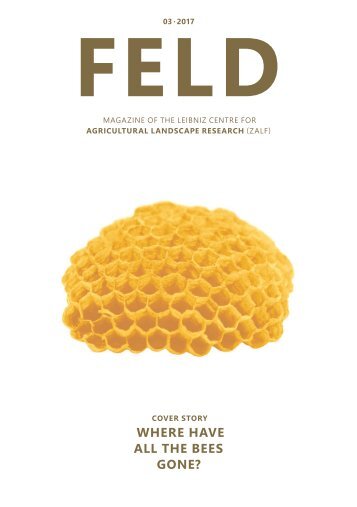


FOLLOW US
Twitter
Youtube
Instagram
LinkedIn